Künstler ohne Werk ist ein autofiktionales Work in Progress, aus dem ich an jedem zweiten Mittwoch hier Ausschnitte veröffentliche.
Viele dieser Shorts stehen in Zusammenhang mit meiner künstlerischen Arbeit, die zu der Zeit entstanden ist, von der der jeweilige Text handelt.
#4 Passaufdichauf
— 1975
Versöhnung
Seit Wochen, seit Monaten …
… magerte er ab. In seinem Bett. Sie hatten ihn auf und wieder zugemacht. Nichts mehr zu machen. Schmerzen, hungern, Morphium, dämmern. Niemand sagt es ihm. Aber man muss es auch nicht verheimlichen. Es ist offensichtlich. Außerhalb des Schlafzimmers wird viel geweint. Drinnen viel geschauspielert.
Ich bin in Lidice. Kapitän der ersten deutschen Fussballmannschaft, die, nach dem Massaker vom Juni 1942, dort spielt. Ein bedrückendes Spiel. Ist uns die Tragweite bewusst? Ja. Nein. Ich kann es nicht fassen. Nicht wirklich. Wir gewinnen 2:1. Durften wir das überhaupt?
Er — hat man mir später erzählt — will nicht sterben, bevor ich wieder zu Hause bin.
Ich sitze an seinem Bett. Er schläft, glaube ich. Es ist nicht wirklich zu erkennen. Dass er die Augen zu hat, heißt nicht, dass er schläft. Auch im Schlaf sieht er angespannt aus. Hat nie das entspannte Gesicht eines Schlafenden, auch wenn der Mund aufsteht.

Der Besuch
In der Wohnung entsteht eine Unruhe. Meine Großmutter. Ich höre ihre Stimme.
— Nein.
Eine Männerstimme gedämpft. Dann wieder meine Großmutter. Sie sagt einen Namen. Heinrich? Welcher Heinrich?
— Das ist doch nicht möglich.
Wieder die Männerstimme. Wer ist das? Ein Arzt? Ich lausche. Sie setzen sich an den Tisch in der Wohnküche. Das kann ich hören. Jetzt reden sie beide. Leise. Durch die verschlossenen Türen verstehe ich nicht, was sie sagen. Höre aber meine Großmutter aufgeregt, ihn ruhiger, besonnen. Weint sie? Was soll ich machen? Ich kann da jetzt nicht rausgehen. Ich bleibe einfach. Packe vorsichtshalber meine Zeichnungen weg.
Und wirklich, sie stehen auf. Verabschiedet er sich? Ich lausche. Er scheint nicht zu gehen. Sie kommen durch das Wohnzimmer auf die Schlafzimmertür zu. Wie deutlich ich das mit den Ohren sehen kann. Die Tür geht auf. Großmutter kommt herein. Offensichtlich hat sie geweint, hinter ihren dicken Brillengläsern. Sie kommt um das große Ehebett, das jetzt mit dem kleinen aufgezehrten Körper noch riesiger aussieht. Schaut mich an. Fragt mich mit einem Blick, ob er schläft, ich zucke mit den Schultern. Gleichzeitig als Antwort auf ihre Frage und als Frage an sie, wer da draußen vor der Tür steht.
Ist es der Arzt mit der letzten Spritze? Ist es jetzt soweit?
Ich stehe auf, lasse sie zu ihm. Sie beugt sich über ihn.
— Willi, was glaubst du, wer da ist.
Er antwortet nicht. Macht aber die Augen auf. Erstaunlich wach.
— Heinrich. Heinrich ist gekommen.
Jetzt ist er wirklich wach. Entsetzt, verraten. Wie kannst du das machen?, fragt der Blick.
Das kann doch jetzt nicht sein. Kennt er den Namen dieses Arztes? Den Namen seines Henkers, seines Erlösers. Jemand, den er duzt, den sie extra um diesen letzten Gefallen gebeten haben. Ich will mich erst noch verabschieden. Richtig. Wie verabschiedet man sich für immer? Ist es das letzte Mal, dass ich ihn sehe. Lebend? Es geht ihm doch heute gar nicht so schlecht.
— Er will dich nochmal besuchen. Er ist hier.
Was geht hier ab?
— Du musst ihn reinlassen, Willi. Er will dich nicht so gehen lassen. Nicht so …
Und zu mir.
— Hilf mir mal.
Ich hebe ihn vorsichtig an. Sie schüttelt das Kopfkissen auf. Stopft ein zweites dahinter. Das ist komplizierter, als es sich anhört. Wir beide auf der gleichen Seite des Bettes. Ich muß mich weit über sie beugen, um ihn halten zu können, sie hängt halb in den Gläsern und Gläschen auf dem Nachttisch. Ich lege ihn wieder ab, in eine Position zwischen sitzen und liegen. Danke, sagen seine Augen.
Er hat aufgegeben, fügt sich.
Großmutter stößt mich an, bedeutet mir, mit rauszukommen. Im Wohnzimmer steht ein Mann aus dem Sessel auf. Garantiert kein Arzt, dafür ist er zu alt. Jedenfalls keiner, der noch praktiziert. Ein grauer abgetragener Anzug, kleine, klare blaue Augen. Das ist alles, was ich wahrnehme und … keine Tasche. Keine Instrumententasche, kein Arzt. Wer dann?

Sie geht mit ihm ins Schlafzimmer, ich stehe an der offenen Tür. Warte. Als sie wieder rauskommt, lehnt sie die Schlafzimmertür an, wir gehen durchs Wohnzimmer in die Küche. Dort liegt sein Mantel über einem Stuhl.
— Wer ist das.
— Sein bester Freund.
Sein bester Freund? Den ich noch nie gesehen habe? Was soll das heißen?
— Wir waren unzertrennlich alle vier. Opa und Heinrich waren zusammen in der Schule, haben in Schwarzweiß zusammen gespielt. Und Heinrich hat sich in Lieselotte verliebt. Meine beste Freundin. Durch die beiden, eigentlich durch ihn, habe ich Opa kennengelernt.
— Wer ist Lieselotte, und warum habt ihr euch nie besucht? Wo wohnen die denn?
— In Bochum.
— Wie hier um die Ecke und ihr habt euch nie gesehen?
— Lieselotte ist im Krieg umgekommen. Bei einem Bombenangriff. Vor dem Rathaus. Bis ’38 haben wir zusammen bei Reichenberg gearbeitet. Wir waren die einzigen Sekretärinnen. Das war so eine schöne Zeit, bis die Reichenberg dann ’38 geflüchtet ist. Die Nazis haben ihr das Geschäft auf der Bongardstraße weggenommen. Sie hat es wohl gerade noch rechtzeitig geschafft. Aber ich hab nie mehr was von ihr gehört.
— Und er hier? Warum hattet ihr keinen Kontakt.
— Wir sind immer zu viert unterwegs gewesen. An der Ruhr zum schwimmen. Mit dem Fahrrad nach Hattingen. Einmal gehen wir bei Mutter Wittig essen. Und weil Willi damals keine Arbeit hatte, will Heinrich bezahlen. Das war’s. Du weißt doch, wie Opa ist. Er ist so beleidigt, dass er nie wieder mit ihm redet. Nie wieder. Seit vierzig Jahren.
Ja, so ist er allerdings. Er redet jahrelang nicht mit meinem Vater, weil der meine Mutter geschwängert hat. Er redet jahrelang nicht mit dem Nachbarn, weil er glaubt, dass er die Hand gehoben hat. Für Hitler. Hatte er nicht. Sagt man.
Kein Wunder der Krebs. Er hat alles in sich reingefressen. Aber das denke ich damals noch nicht.
Im Garten
Eine Bitte hat er, als ich mich neben sein Bett setze. Noch einmal den Garten sehen. Wie soll das gehen? Auf einem Stuhl? Ich hole einen kleinen gepolsterten Sessel aus dem Wintergarten. Seinem Kabäuzchen. Trage ihn ans Bett.
Wie soll ich ihn hochheben? Haut und Knochen. So sagt man das. Sein Kopf sinkt nicht mehr ins Kissen ein. Zu leicht. Ich schlage die Bettdecke weg. Aus dem Nachthemd ragen die Knochen. Die Arme. Die Beine. Blau, gelb, rot und viel weiß. Wie kann ich ihn hochheben, ohne dass die Knochen, die Haut durchstechen. Sie ist zäher als sie aussieht. Ein Arm unter die Schultern, einen unter die Beine. Er zuckt. Es tut weh. Aber er schaut mich an. Entschlossen. Okay. Ich hebe ihn an. Er wiegt nichts. Nicht mehr als Knochen wiegen. Ein eingenähtes Skelett.
Er sitzt. Jetzt noch das Kopfkissen auf den Schoß. Ich trage ihn durch die Wohnküche ans Fenster. Seine Füße, das einzige, was mir größer vorkommt, unfähig schon zu gehen.
Die Sonne scheint. Die Obstbäume stehen in Reihen. Die Wäsche flattert im Wind. Auf den Feldern Gemüse. Kohl. Kartoffeln. Er wird es nicht mehr ernten. Und bald wird es das alles nicht mehr geben. Für ihn nicht. Auch für die anderen nicht. Alles muss pflegeleichter werden. Und niemand wird die Kaninchen schlachten können oder die Hühner. Weint er? Er ist eingeschlafen.
Ich weine. Trage ihn zurück. Ins Bett. Die Bettdecke kommt mir unendlich schwer vor. Sie könnte ihn zerquetschen.

Die Zeichnungen
Ich zeichne ihn.
Den Schädel, die Fadenhaare, den Fadenspeichel. Das Gebiss im Glas, könnte längst weg. Er kaut schon lange nichts mehr. Die Hände. Wie die von August Forel auf Kokoschkas Bild im Folkwang Museum. Nur knochiger. Ich male zu der Zeit immer wie irgendjemand. Flaschen wie Morandi. Äpfel wie Cezanne. Röhren wie Legér. Assamblagen wie Braque.
Aber das hier fühlt sich anders an. Ich schmuggle die kleinen Blöcke unter dem Pullover in Schlafzimmer. Ich schäme mich für die Zeichnungen. Nein, ich schäme mich nicht. Ich hoffe nur, dass mich keiner erwischt. Dass er es nicht merkt, unbewusst. Dass keiner merkt, dass ich einfach so hinschaue, zuschaue, während er schläft oder ohnmächtig ist, im Morphiumdämmer und stirbt.
Im Kohlenkeller male ich es dann alles nochmal in Öl auf Pappe, schnell, hastig. Verstecke alles hinter der Werkbank. Das darf keiner hier sehen. Ein Jahr später werde ich dafür auf der Akademie angenommen. Braque und die anderen haben es nicht in die Mappe geschafft. Gott sei Dank.
Vierzig Jahre später landen die Erinnerungen an diese Zeichnungen in einer Graphic Novel.
pssaufdschuf
— pssaufdschuf.
Hat er das gesagt? Hab ich das nur gehört? Was? Pass auf sie auf.
Auf wen? Auf seine Tochter, auf meine Mutter?
Seine Frau? Meine Großmutter?
Oder Plural? Pass auf sie auf! Auf alle hier?
Oder nicht? Hat er nur schwer geatmet, zwischen den Speichelfäden auf seinen dünnen Lippen.
Ich nicke. Ja mach ich. Ich drücke im leicht die Knochen seiner Hand. Ich hab verstanden. Drückt er zurück. Kann sein.
In der Nacht bekommt er seine letzte Spritze. Der Notarzt weiß, was er tut.
Am nächsten morgen lächelt er entspannt. Jemand hat ihm schon das Gebiß in den Mund geschoben. Die Augen geschlossen, fast zu, und das Kinn festgebunden. Als ich ins Zimmer komme, ist er schon kalt. Schon weit weg. Wohin?
— Pass auf dich auf.
Ja. Das muss er gemeint haben: Pass auf dich auf.
Hoffentlich.

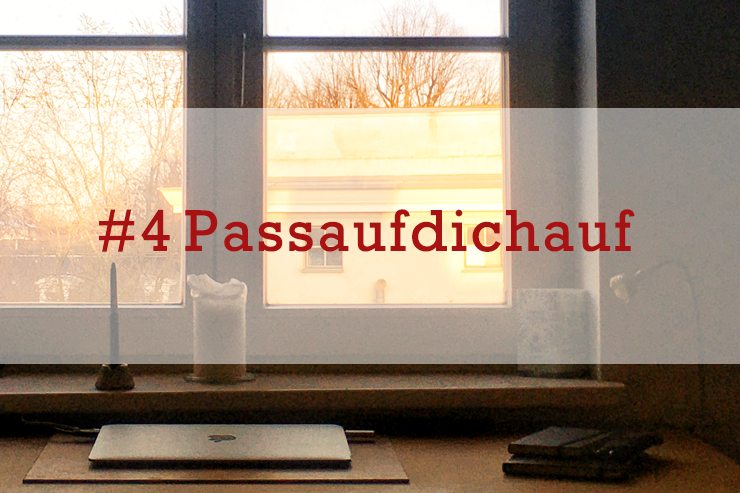

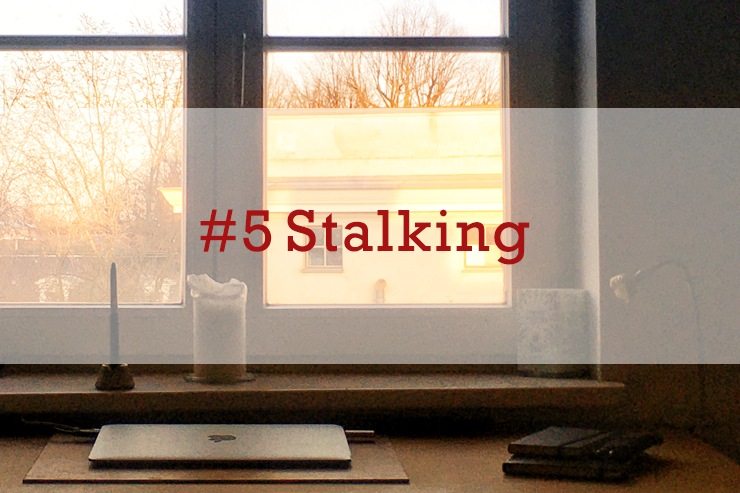
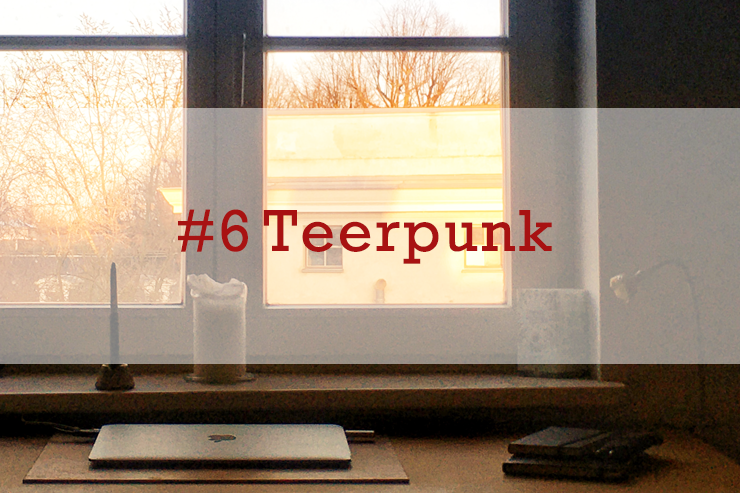


16 Comments