Künstler ohne Werk ist ein autofiktionales Work in Progress, aus dem ich an jedem zweiten Mittwoch hier Ausschnitte veröffentliche.
Viele dieser Shorts stehen in Zusammenhang mit meiner künstlerischen Arbeit, die zu der Zeit entstanden ist, von der der jeweilige Text handelt.
#20 Blackout
— 1984
Ich habe jeden Tag genau im Kopf.
11.6.82 Randale auf der Reagan-Demo.
22.9.82 Rattays Tod unter dem Bus.
1.11.82 Die Maaßenstraße wird geräumt.
27.6.83 Die letzte große Räumung. Das sind wir.
Jetzt weiß ich kaum, in welchem Jahr wir sind.
Nichts ist erleuchtet. Alles ist betäubt. In den Mustopf dringt kein Licht.
Noch kurz vor dem Mittagsschlaf sagt sie, dass wir auch gut zusammen wohnen könnten. Höre ich das nicht?
Ich laufe. Laufe durch die Stadt von Kreuzberg nach Charlottenburg. Der Nieselschnee schmilzt auf meinem Kopf. Das Granulat knirscht unter meinen Schritten. Das sind nicht meine Schuhe. Ich habe seine Schuhe an. Stimmt. Ich wohne ja in seiner Wohnung. Er ist in New York.
Jetzt bin ich frei. Sozusagen wohnungslos, doch frei. Wir werden etwas Gutes finden, endlich zusammensein.
Ich weiß nicht mehr, wie ich hierher gekommen bin. Fahre mit der XT an der heruntergelassen Schranke vorbei auf das Gelände. Suche im Schritttempo das Gebäude. Nein, ich bin ja zu Fuß. Das Motorrad ist verkauft, oder noch nicht? Hatte ich sie denn gar nicht hingefahren? Wie ist sie denn überhaupt hierher gekommen? Ist es denn überhaupt hier? In dieser Klinik?
Doch. Hier ist das Gebäude. Gynäkologie. Ich finde die Station. Möchte dabei sein, wenn sie aufwacht.
— Sie können jetzt noch nicht zu ihr. Sie ist noch im Aufwachraum.
— Genau da möchte ich ja hin.
— Wir rufen sie, wenn sie wieder auf der Station ist. Sie können solange im Wartebereich Platz nehmen.
Ich warte, den Helm zwischen den Beinen.
Da schiebt man sie an mir vorbei. Sie hat mich nicht gesehen. Ist sie schon wach?
Endlich. Sie liegt im vorderen Bett.
Am Fenster schläft noch jemand. Schläft? Eine junge Mutter, eine Tumorpatientin oder auch eine Abtreibung? Ich bleibe an der Tür. Ist sie schon wach? Dann lächelt sie mich an. Die Augen zu. Ich traue mich und gehe rein. Müde schaut sie mich jetzt an. Erschöpft. Und klar.
Ich lege meinen Helm auf den Boden, setze mich auf die Bettkante. Will mich auf die Bettkante setzen.
— Was machen Sie denn da? Sie können so nicht auf dem Bett sitzen. Der Eingriff ist noch keine Stunde her.
Ein Pflegerin ist über sie gebeugt, schaut gar nicht hoch.
Behandelt mich wie einen … ist das Verachtung? Wie den letzten Dreck. Was hat sie gegen mich? Ich bin hier, will bei meiner Geliebten sein. Das müsste sie doch sehen. Ich bin da. Ich bin doch da. Für sie.
— Doch nicht in diesen Sachen.
Was ist mit meinen Sachen? Was nimmt sie sich denn heraus? Ihr Urteil ist gefallen.
Was hätten wir denn machen sollen?
Ich stehe auf. Sie ist blaß. Sieht müde aus, ist müde. Ich suche ihre Hand, sie drückt meine. Lächelt mich an, ganz klar.
Was ist denn los? Ist was schief gelaufen? Hat sie Schmerzen? Nein.
Sie schüttelt den Kopf.
— Ich bin müde. Du musst jetzt gehen. Komm morgen wieder.
— Wie lange musst du denn …
Sie schüttelt wieder den Kopf. Mir wird schwindelig. Von den Seiten wird es dunkel und mir wird klar: Was habe ich da gemacht?
Ich fahre. Ja wohin? Ich weiß nicht mehr, wo ich zu Hause bin. Wo ich grad wohne. Ich kann mich nicht erinnern. Nur an den Wind und Winternieselregen. Es ist längst dunkel. Immer dunkel in der Stadt. Im Winter.
Und still. Alles ist still und schreit in mir. Ich höre Schnee. Ganz leise trifft er mein Gesicht. Er schmilzt im gelben Licht auf der Laterne. Schwebt herunter, landet, schmilzt. Ich sehe Blut und Schleim. Ich träume große helle Augen. Ich sehe unser Kind. Erschrocken. Was macht ihr da? Ich höre. Das kann doch nicht sein. Dann wieder saugen. Saugen. Saugen. Was macht ihr da mit mir?
Dann gleitet alles weg. Die Augen zu, betäubt. Und Schluss. Alles ist nass, von Tränen, Rotz und Schnee. Mein Gesicht fließt mir vom Schädel. Mein Rachen voller Knoblauchzehen. Mir fallen alle Zähne aus dem Mund. Ich schrecke auf. Über mir im dunklen Licht, erstaunt mein Kind. Unglaublich die Enttäuschung, die Vergebung. Ein blondes Lächeln hinter der Laterne. Der Schnee. Schon gut. Macht’s gut. Fällt weiter. Schmilzt.
— Nein. Warte. Es tut mir leid. Es tut mir leid, mein Kind. Es …

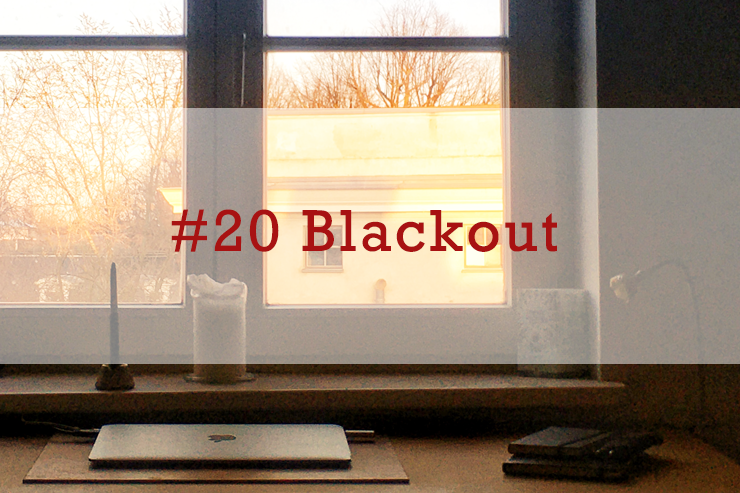
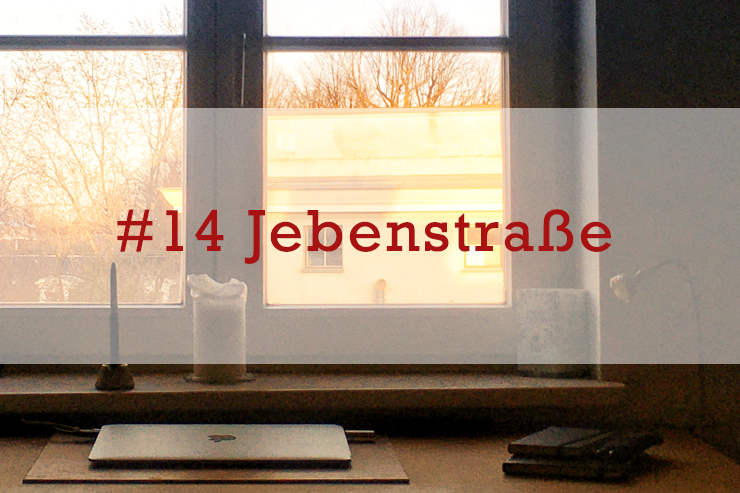
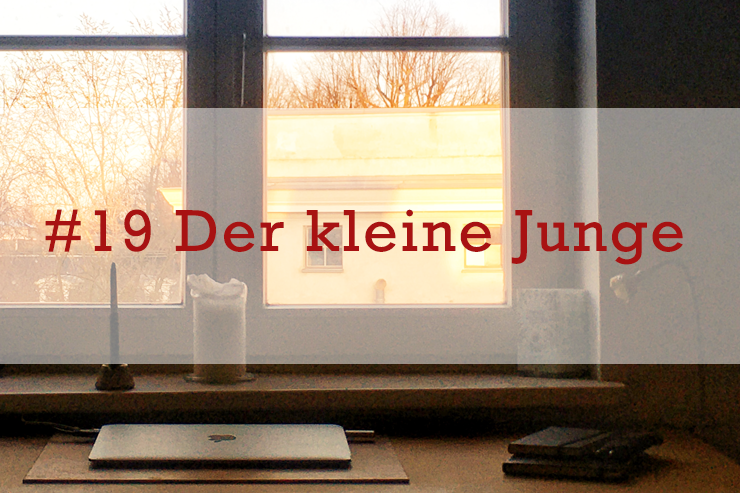



18 Comments