Künstler ohne Werk ist ein autofiktionales Work in Progress, aus dem ich an jedem zweiten Mittwoch hier Ausschnitte veröffentliche.
Viele dieser Shorts stehen in Zusammenhang mit meiner künstlerischen Arbeit, die zu der Zeit entstanden ist, von der der jeweilige Text handelt.
#14 Jebenstraße
— 1985
Nach der unverschämten Zeit
… in den besetzten Häusern West-Berlins und nach dem schwersten Fehler meines Lebens, studiere ich zur Erholung Kunstgeschichte in Bochum. Und ja Germanistik. Die ganze Stadt ein Sanatorium, alles ist einfach, ruhig. Die kleine Dachwohnung der Baugenossenschaft, eher ein Zelt, aber geheizt, mit Bad und Flurwoche. Sie sieht am Abend so aus, wie ich sie morgens verlasse, niemand da. Ruhe. Selbst das Brötchenholen ist einfacher als in Berlin.
Die Tage eingetaktet. Eine Kur mit Anwendungen. Hier heißen sie: Seminare, Vorlesungen, Hausarbeiten und Referate. Die Lücken füllen sich mit langen Spaziergängen und gelegentlichen Joggingrunden um den Baldeneysee. Gegen die aufkommende Einsamkeit helfen Honigbrote, unzählige Honigbrote.
Pflastersteine, Molotows, Kunst und Sperma. Rumschleudern, sprühen und abspritzen. Vorbei.
Ich sauge auf. Ich lese, lese, bis die Bibliotheken schließen. — Und schreibe.

Konzentration durch Enthaltsamkeit, kein Alkohol, kein Motorrad, kein Schlagzeug, kein Feuerspucken und Jonglieren, kein Fleisch, kein Sex und vor allem — keine Kunst.
Was ich noch male sind Auftragsarbeiten, Kinderporträts nach Fotos, Landschaften mit Pferdegespannen, Ornamente auf Bauernschränke. Alles mit dünnem Pinsel. Trotzdem schaffe ich es, Ölfarbe am Ellbogen zu haben, an der Butterdose, auf dem Kopfkissen und am Badewannenrand. Selbst das bekomme ich nicht unter Kontrolle, das muss ganz aufhören. Es hört auf. Ich bekomme einen HiWi-Job am Kunsthistorischen Institut. Nie wieder malen.
— 1988
Drei Jahre lang.
Ich mache meinen Job und bekomme Geld. Ich studiere und bekomme Stempel. Ich lege Prüfungen ab und bekomme Zeugnisse. Mein Doktorvater bekommt einen Ruf an die Freie Universität. Ich soll ein Stipendium bekommen und sitze aufgeregt in seiner neuen Wohnung in Berlin.
Seine Frau bringt, während ich warte, dünnen Tee, wahrscheinlich sehr guten, in Arzberg-Geschirr. Passend zu dem hellen Arbeitszimmer. Bücherzimmer. Bücher. Bis an die Decke. Bücher mit denen ein Mensch lebt. Ein Mensch, der die Kunst betrachtet, der sie versteht, erklärt, sich nicht hineinziehen lässt. Nicht in das vollkommen Unbekannte des Kunstmachens. Genau da will ich hin. Mich nicht mehr hineinziehen lassen in die Kunst. Sie von außen betrachten, sie verstehen, sie erklären, mir und anderen. Er kommt, entschuldigt sich.
Wir reden noch einmal über das Charisma Max Imdahls
… und wie er jetzt fehlt. Das letzte Mal haben wir uns auf seiner Beerdigung gesehen. Es blitzt eine Erkenntnis an meinem linken Auge vorbei, die ich nicht festhalten kann. Imdahl, Kunst, Vorlesungen, er ist ein Künstler. War er einer? Vorlesungen als Kunst, seine waren es, ein Wühlen, ein Graben im Unbekannten, ein Sehen, um zu wissen. Gewissermaßen. Das ist sein Wort. Jetzt ist er tot. Deswegen? Was hat ihn zerfressen?
Zuversichtlich nervös, erläutere ich den Stand meiner Dissertation. Er findet alles sehr überzeugend, versichert mir für das Stipendium ein positives Gutachten und verabschiedet mich mit nur zu, weiter so.
Weiter so, nur zu
fahre ich also täglich in die Kunstbibliothek. Jebenstraße, direkt neben dem Bahnhof Zoo. Große grüne Tische, endlose Schubladenkataloge mit Karteikärtchen, eine Theke, über die ich Bestellungen schiebe, um mich dann an einen freien Platz zu setzen und zu warten. Auf die bestellten Bücher und historischen Zeitschriften. Eine endlose Zeit, zwischen den wenigen, aber beschäftigten, entschlossenen, zielgerichtet arbeiteten Lesern, Studenten, Doktoranden und den von mir bewunderten und beneideten, oft auch schon etwas kauzigen, immer gleichen älteren Leuten, die dort offensichtlich nur aus Wissensdurst, Neugierde oder interesselosem Wohlgefallen sitzen, lesen und lernen.
Auch ich habe mir so eine Strickjacke zugelegt. Eine Studierstrickjacke, wie sie Robin Williams zehn Jahre später in Good Will Hunting trägt, wenn er Matt Damon immer wieder erklärt it’s not your fault, it’s not your fault, it’s not your fault. Aber sie hilft nicht. Nicht mehr. Ihm nicht und mir nicht.
Noch bevor meine Bücher überhaupt auf der Theke erscheinen, bin ich völlig fertig mit den Nerven, will nur weg hier. Fühle mich eingesperrt, fehl am Platz. Ich weiß, die ganze Lektüre wird mich nicht weiterbringen, mir im Gegenteil noch mehr zeigen, was ich alles nicht weiß, was ich übersehen werde, was ich ausschließen, was ich unbedingt einbeziehen muss. Ich weiß, dass sie mich weder dem Abschluss der Dissertation näher bringen wird, noch meinem Lebenstraum, was immer der sein sollte. Die Bücher kommen.
Ich schlage sie auf. Wahllos.
Inhaltsverzeichnisse verschwimmen.
Ich blättere. Lese.
Vor, zurück.
Überfliege.
Blättere um.
Versuche, mich zu konzentrieren.
Konzentriere dich.
Mich zu erinnern, warum ich sie überhaupt lesen will.
Beruhige dich.
Welcher Gedanke hatte mich getrieben, sie zu bestellen, auszuleihen?
Welche Erkenntnis hatte ich mir versprochen, als ich vor gut einer halben Stunde hektisch die Titel von den Karteikärtchen im Katalog abgeschreibe und dann auch noch über die Theke reiche.
Ich schlage das nächste Buch auf, finde eine, irgendeine interessante Stelle.
Lese mich für Minuten fest.
Schreibe ich ein paar Passagen ab. Obwohl ich sicher bin, dass ich – erstens – meine Handschrift morgen nicht mehr lesen können werde und dass ich mir – zweitens – das Ganze nicht mehr anschauen werde. Aber darauf kommt es nicht an.
Das Abschreiben gibt mir jetzt gerade etwas Halt. Ich kann so tun, so tun als ob. Als ob ich arbeiten würde, als würde ich wichtige Exzerpte von etwas Wichtigem machen. Als hätte es wirklich Sinn gemacht, die Bücher zu bestellen. Dabei ist alles unscharf vor meinen Augen. Alles ist Herzrasen und kalter Schweiß auf der Stirn.
Wie lange muss ich noch warten? Ich kann ja nicht sieben, acht oder wieviel Bücher extra aus dem Archiv holen lassen, um sie nach zehn Minuten wieder zurückzugeben.
Wie sähe das aus?
Soll sich der arme Mensch hinter der Theke verarscht fühlen?
Würde er mich entlarven?
Mich erkennen als jemand, der so tut, als würde er studieren und in Wirklichkeit gar nicht hierher gehört? Weiß er schon, dass ich ein Betrüger bin, der nur so tut, als könne ich gute Arbeiten schreiben, erhellende Referate halten?
Als wüsste ich die Antworten
Dabei habe ich mir das alles nur angelesen. Habe einfach nur gelernt. Für die Prüfungen. Habe Vorträge von Professoren an der Kunstakademie analysiert, Redewendungen, Fachbegriffe, rausgeschrieben. Aufbau und Struktur von Vorlesungen notiert. Und dann einfach – Malen nach Zahlen – mit meinen Themen gefüllt. Alles angelesen und gelernt. Sie werden mir auf die Schliche kommen. Sie werden merken, dass ich nicht einer von ihnen bin. Dass ich in Wirklichkeit kein Wissenschaftler bin, dass ich mich hier nur ausruhen, erholen will in einer Gesellschaft mit Benotungen, Stempeln, Unterschriften, Fleißkärtchen und Gehältern.
Ich will mir selbst beweisen, dass ich nicht mehr an der Nadel der Kunst hänge. Dass ich geheilt bin. Dass ich eine Existenzberechtigung habe.
Ich blättere weiter. Ich werde etwas Sinnvolles zu Papier bringen. Was meinte er mit überzeugend – nur zu, weiter so? Er will mich nur loswerden, hat gemerkt, dass ich nicht dazugehöre.
Dass ich nur so tue als ob.
Er hat mich durchschaut.
Gleichzeitig tut er mir leid.
Es tut mir leid, dass ich ihn hängen lassen werde.
Er hat vollstes Vertrauen in mich, hat mich immer unterstützt.
Ich werde ihn sehr enttäuschen.
Und ich bekomme das Stipendium nicht.
Ich schäme mich.
Mit einer genuschelten Ausrede gebe ich die Bücher zurück.
Ja, Sie können sie bis morgen hier oben lassen.

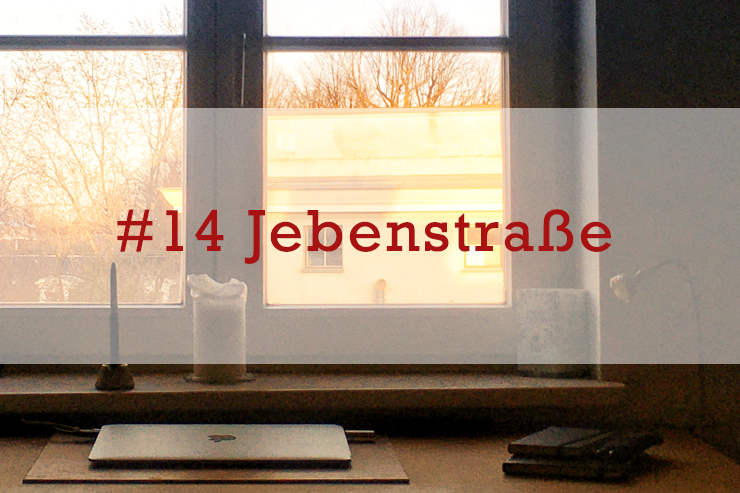

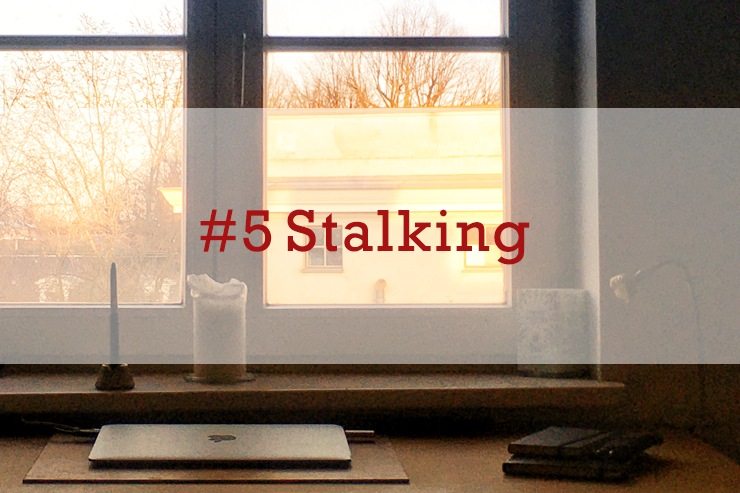
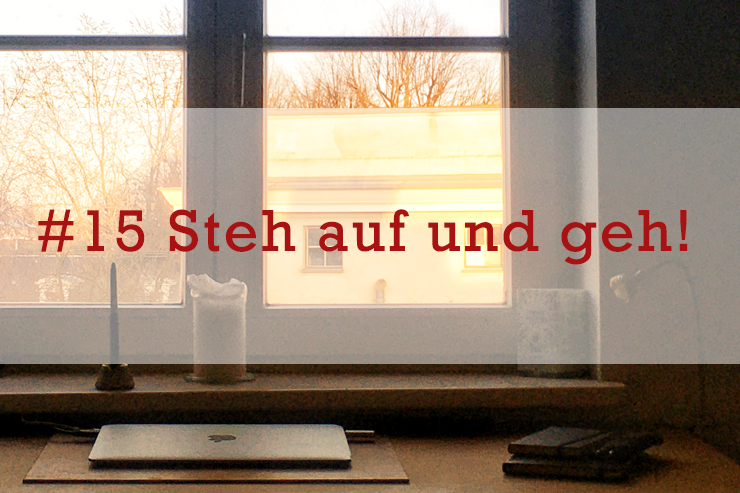
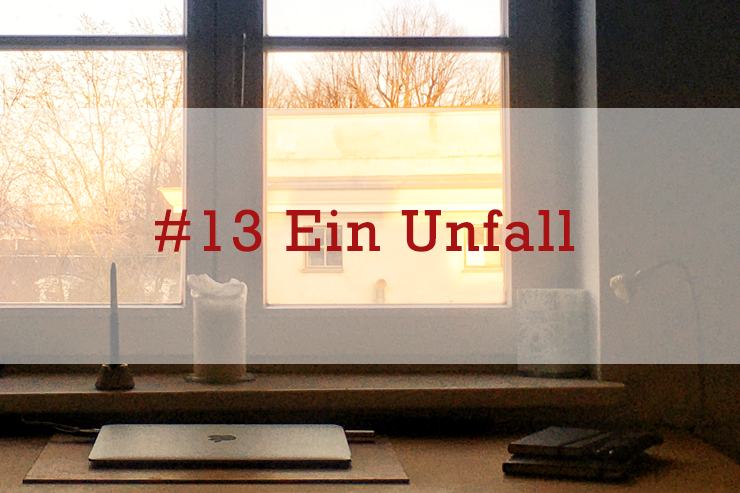
17 Comments