Das Problem des Schriftstellers, überhaupt des Künstlers, ist doch, daß er sein ganzes werktätiges Leben versucht, auf das poetische Niveau seiner Träume zu kommen.
(Heiner Müller)
#9 Das Kamel
Erst kommt Besuch oder ist schon da, als ich merke, dass ich träume. Eine Frau, eine andere etwas farblose Autorin steht da wie selbstverständlich. Geht an mir vorbei, will nach oben zu K. In ihr Schreibzimmer. Kann sein, sie kennen sich von einem gemeinsamen Stipendienaufenthalt in irgendeinem Schloss.
Ich ziehe mir eine Hose an, bin noch in Boxershorts vom Schlafen. Sie kochen Kaffee, oben. In unserer Kaffeetrinkzeit. Sauer, beleidigt, was soll das, gehe ich. Kaffee trinken. Eben allein. Oder nein, sie gehen Kaffee trinken, obwohl? Und ich gehe nicht mit.
Trotzdem, nein, nicht trotzdem, einfach so bin ich dann in einem Café. In einer Art Glaspavillon, der eigentlich ein Ausstellungsraum ist, aber auch dafür völlig ungeeignet, wegen der umlaufenden Glaswände, des sich ständig ändernden grellen Lichteinfalls und wegen der fehlenden Wände, an denen man Bilder aufhängen oder projizieren könnte. Wie etwa der Pavillon auf der Freundschaftsinsel.
Gleichzeitig erinnert mich der Spirit des Raums an das Café in der Suarezstraße, in dem wir in den 80ern, als wir noch in den Häusern in Charlottenburg wohnten, des öfteren gefrühstückt haben und zu dem wir später manchmal mit unseren Motorrädern aus Kreuzberg gefahren sind. Während der gesamten Dauer dieses Traums laufen die eingängigen Riffs von »Like a prayer« als Soundtrack mit. Aber nicht als Ohrwurm, wie noch beim Einschlafen und später beim Aufwachen, sondern als Traummusik. Als echte Musik, die nicht nur in meinem Innenohr, sondern im Traum stattfindet und um ihn herum wabert. Wie hieß noch das Café?
Für den Pavillon auf Freundschaftsinsel spricht, dass da auch ein Wasser ist. Ein langsam fließender, breiter Fluß. Die Havel wäre naheliegend? Die alte Fahrt? Das Wasser ist jedenfalls nicht so breit, wie der Rhein in Düsseldorf, über den Anotal Herzfeld, von Wasserschutzpolizei und Froschmännern begleitet, in seinem selbstgeschnitzten Einbaum mit einigen schnauzbärtigen Mitstreitern eingepackt in Rettungswesen paddelt, um seinen Lehrer Joseph Beuys zurück in zu holen in die Akademie der Kunst. Der sitzt aufrecht, mit dem Blick konzentriert nach vorn, gespannt und entschlossen im Bug des ausgehöhlten Baumstamms, Das Paddelgedöns im Rücken geht ihn nichts an. Fokussiert nur auf sein Bild. Washington bei der Überquerung des Delaware. Triumph und Tod des Helden.
Bevor er den Triumphschritt macht, stehe ich schon irgendwo am Niederrhein auf einer Überschwemmungswiese, wo die Menschen Maultrommel spielen und gleichzeitig Akkordeon mit ein wenig Saxophon. Freejazz auf Melodica und Ukulele, eben weil das Land so weit ist, wo so viel Strecke zwischen den Wallfahrtskirchen liegt, der Wind über das Gras weht und das Zigarettenpapier aus Holland so nah ist. Rolt beter, brandt beter, plakt beter.
Zwischen den blattlosen Ästen der einzigen Weide auf diesem sumpfigen Wiesengelände hängt eine Krawatte, nein ein Gürtel. Ich ziehe. Er dehnt sich, ist überlang. Wird länger, je mehr ich ziehe. Ich bekomme ihn nicht ab. Ich ziehe und ziehe, versuche, mit einer Hand die Schnalle zu schließen. Schaffe aber auch das nicht. Weiß nicht, warum ich nur eine Hand zur Verfügung habe und frage mich das auch nicht.
Der Edeka-Punk wird (nicht von mir) zur Hilfe gerufen, weil der Gürtel jetzt so verheddert ist, verdreht. Ach, es ist ein Gitarrengurt. Wir ziehen ihn lang. Ich hänge, halte, ziehe. Lege mich mit dem Ende des Gurts in beiden Händen auf den Bauch. Mit dem ganzen Gewicht. Rolle, drehe mich ein. Verheddert, entheddert. Als alles fertig ist, sitzt der Punk neben mir, ritzt sich etwas in den Arm. Ich entschuldige mich.
—Ich war eingeschlafen.
Alle, alle? lächeln wissend, schließen kurz mit einem leichten Nicken zustimmend die Augen.
Doch ich schlafe immer wieder ein, in meinem eigenen Traum. Ich bin so müde.

Da treibt im Fluß ganz langsam ein etwas zerrupftes Kamel vorbei. Über und über mit Reflexionsfarbe besprayt. Das struppige Fell leuchtet orange. Damit ich es bemerke.
Noch andere Tiere schwimmen vorbei. Tiere, die man eher in einem Fluß vermutet, ein toter Hund, eine Ente, mehrere Enten. Ein unsichtbares Flusspferd bleibt unter Wasser. Ein Schwan soll geschlachtet werden. Eine Grube für das Feuer ist schon ausgehoben.
—Ich esse kein Fleisch.
Das leuchtende Kamel, weiß ich jetzt, ist nur vorbeigedriftet, damit ich an seiner Skurrilität bemerke:
—Hallo, das kann doch gar nicht wahr sein. Du träumst wohl, schreib das auf.
—Nein, ich bin zu müde.
Ich bleibe liegen. Müde wie der tote Hund. Auf einem rauen Boden aus gebrannten Ziegeln. Im Gewölbekeller des Cafés.
Aus dem Nebenraum wirft sich ein Kind, ein dünner Junge, vier Jahre, oder sechs, auf mich. Liegt auf meinem Brustkorb.
—Bist du sicher, dass du hier richtig bist?,
Oder warte, fragt er mich das? Frage ich mich selbst? Die Frage. Niemand stellt sie, sie ist einfach da. Aber sie steht nicht im Raum, wie so gesagt wird. Sie wabert, oszilliert und schwebt herum. Von einem zum anderen. Einfach so.
Die Wand zum Nebenraum ist halb herausgebrochen. Dahinter sitzen Frauen auf dem Boden. Sein Tribe? Der Jung nickt. Es ist keine Verwechslung. Ich wuschel ihm durch die Haare. Er legt den Kopf auf meine Brustkorb, schläft ein. Ich genieße das bekannte, wohlige Gewicht. Ich bin es selbst. Höre meinen Herzschlag an seinem Ohr. Die Frauen, seine Mütter schmunzeln von drüben.
—Frag den Mann, ob du Keksbeeren im Mund hast.
—Ja?
—Sollst du aber nicht.
Neben uns in dem Gewölbe, das jetzt viel größer ist, wird schon die ganze Zeit Kleinkunst geboten. Jonglage, Feuerzauberei, Open Mic. Jetzt geht hinter mir die Energie eines kleinen, dicken Jemand vorbei. Kündigt an, was sie jetzt spielen wird. Ich verstehe, Neil Young. Glaube, es gehört zu haben. Hat der Jemand das gesagt? Ich stützte mich auf die Ellenbogen, immer noch den schlafenden Jungen auf der Brust.
Der Jemand setzt sich auf eine grasbewachsene Böschung in dem Gewölbe. Mit einer unbekannten Handtrommel und einer Wappenfahne kündigt er drei lange Lieder an. Auf arabisch oder türkisch, das weiß er selbst nicht so genau. Obwohl ich die Sprache nicht verstehe, weiß ich, dass er von Herrn Birnbaum auf dem Dachboden singt. Ich springe auf. Stemme meine Hände in die Hüften. Der Junge hockt auf dem Boden. Umklammert mein Bein. Zufrieden. Sicher.
—Ich kenne die Geschichte.
Der Jemand ruft zurück.
—Ich erfinde sie gerade.
Er, der Herr Jemand hat jetzt ein Babykostüm an, einen Zwangsjackenstrampler. Und zwar so geknöpft, gebunden und verschnürt, dass man nicht erkennt, wo vorn und hinten ist, wie bei Schauspielern, mit einer Maske auf dem Hinterkopf und weißer Schminke im Gesicht. Mit zweite Gesichtern oder keinem.
Er läuft herum, lacht, tanzt und nervt. Er dreht sich weit weg, und dann sehr nah, abwechselnd und gleichzeitig. Zeigt seine um den Bauch geschnürten Arme. Wie der Stelzenmann auf dem Mittelaltermarkt erschrickt er die Kinder und die Leute. Nur mich nicht.
Ich versuche, sein Gesicht zu sehen, es ist mal vorne und mal hinten, oder gar nicht da. Ich sehe nur Tücher. Gurte, die sich stramm um seinen runden Körper. Ein Kokon. Ein Schmetterling?
Ich liege wieder auf dem Rücken, trete beiläufig im Liegen plötzlich wieder, oder immer noch sauer und beleidigt gegen die Steine aus der Backsteinmauer, hinter der K. und die Autorenfreundin sitzen. K. ist mittlerweile auch gelangweilt.
—Dann krieg wenigstens was raus!
K. dringt der Autorin wortlos in den Kopf. Die versteht, ist jetzt auch beleidigt und geht im Versuch, Haltung zu bewahren. Haltung, Haltung, Haltung! Was trägt Sie denn? Was trägt Sie denn?
—Was trägt dich denn Herr Jemand? Das Leuchten in den Augen?
Die Ehre, die Ehrfurcht oder die Furcht?
Ich kenne deinen Namen, Herr Baron?





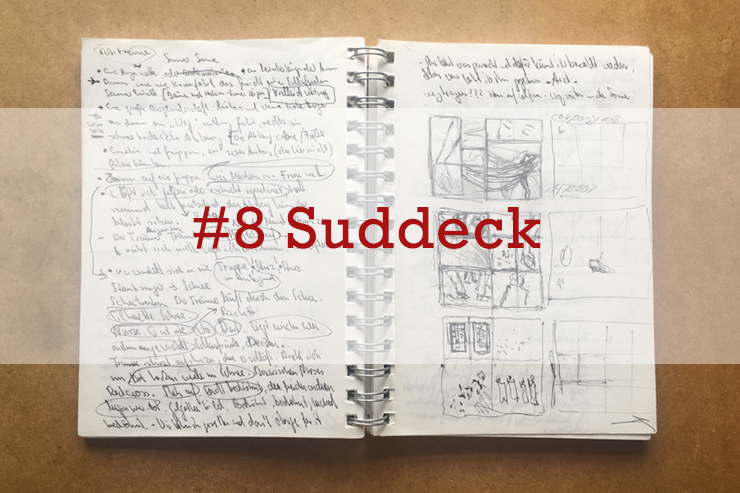

No Comments