Liebe Autor*innen, liebe Leser*innen, heute geht es in der Reihe über autobiographisches Schreiben um Sterben von Karl Ove Knausgård. Sterben ist der erste Band eines zwischen 2009 und 2011 erschienenen sechsbändigen autobiographischen Projekts. Knausgård nennt diese Reihe »Min Kamp« Bei der Herausgabe der Bände hat der Luchterhand Verlag, wohlweislich auf die wörtliche Übersetzung des Reihentitels verzichtet. Dort sind alle sechs Bände zwischen 2011 und 2017 unter den Titeln Sterben, Lieben, Spielen, Leben, Träumen, Kämpfen in der Übersetzung von Paul Berg erschienen.
Ich habe die ungekürzte Hörbuchfassung aus dem Hörverlag gehört, großartig gelesen von Sascha Rotermund. Karl Ove Knausgård gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen autobiographischen Autoren.
Der Verlag nennt das Buch einen Roman, obwohl es ein eindeutig autobiographischer Text ist. Knausgård beschreibt – vermutlich aufrichtig – die Nöte seiner Kindheit und Jugend. Allerdings in einer Ausführlichkeit und Detailgenauigkeit, die ans romanhafte grenzt. Ständig erfährt man, wer, wann, was anhatte, ob man sich einen Tee machte oder nicht und wer was zu wem sagte. Hier greift Knausgård mit seinen literarischen Mitteln ein und verwischt gerade durch die Pseudogenauigkeit die Grenze zur Fiktion. Ob das alles erzählenswert ist … ich weiß es nicht.
Aufgemerkt habe ich beim Hören, als Knausgård fast beiläufig und unreflektiert gesteht, dass er vom Familienleben, insbesondere von seinen kleinen Kindern oft so genervt ist, dass er sie – ja man muss es so nennen – misshandelt.
Ich habe mich deshalb entschlossen, diesen Beitrag unter einen allgemeineren Aspekt zu stellen, als die voran gegangenen.
Für mich stellt sich die Frage – und das ist auch gleichzeitig die Frage zum autobiographischen Schreiben, die ich euch in diesem Beitrag stellen möchte: Ist es nicht an der Zeit, seine Kreativität nicht nur auf den »echten« künstlerischen Prozess, wie hier auf das Schreiben, zu beschränken?
Schon bei anderen autobiographisch arbeitenden norwegischen Autoren ist mir aufgefallen, wie sehr sie in ihrem Schreiben, für ihr Schreiben leben. Das ist großartig. Sie beschreiben nicht nur ihr Leben, sondern ihr Leben wird auch durch das Schreiben bestimmt. Dabei vernachlässigen sie, um des Schreibens willens immer wieder ihre Beziehungen. Espedal etwa findet nach dem Tod seiner Frau keine Ebene mit seiner fünfzehnjährigen Tochter, sondern schreibt. Auch Lindstrøm lässt sich von ihrer, um Aufmerksamkeit bittenden, Tochter nicht vom Schreiben abhalten. Gut, so etwas kommt ja leider nicht nur unter Schriftstellern vor, schon gar nicht nur unter norwegischen. Work-Life-Balance – gibt es sowas?
Mir kommt es seltsam vor, dass dem Schreiben eine dermaßen große Bedeutung beigemessen wird, und es sich nicht auf die Kreativität in anderen Lebensbereichen auswirkt. Ich frage mich das auch in diesem fiktiven Brief an Karl Ove Knausgård:
Lieber Karl Ove Knausgård,
gerade habe ich dein Buch Sterben gehört. Vorher hatte ich viele Passagen aus Spielen gelesen.
Deine Beschreibung des Selbstbildnisses von Rembrandt und deine Reflexionen über die Alterslosigkeit von Augen gehören zu dem Besten, was ich in der letzten Zeit gelesen habe. Es kommt nicht oft vor, dass die Lektüre eines Buches einem, oder sagen wir ruhig mir, eine ganz neue Sicht auf einen Ausschnitt Welt gibt. Meine Sicht auf die Welt, oder einen Aspekt der Welt ändert oder zumindest shiftet.
Was mich traurig oder nein, sogar zornig gemacht hat, ist die Schilderung deiner Beziehung zu deinen Kindern. Wenn du deine Ungeduld, deine eskalierende Wut beschreibst. »Es kam vor, dass ich sie außer mir vor Wut hochriss … es kam auch vor, dass ich ihren Tränen begegnete, indem ich sie anschrie auf ihr Bett warf und festhielt, bis es aufgab, was sie ritt.« »Schreie, die mich jegliche Selbstbeherrschung verlieren, aufspringen und zu dem armen Mädchen laufen ließen, das angeschrien und geschüttelt wurde, bis seine Schreie in Tränen übergingen.«
Vermutlich ist es wohl wirklich so passiert, und es ist bewundernswert ehrlich und mutig von dir, dass du dich so darzustellen traust.
Es gibt ja noch keine MeToo Bewegung von Kindern. Es gibt noch keine Ächtung von Schriftstellern, die ihre kleinen Kinder misshandelt haben. Vielleicht ist das auch gut so. Ich weiß es nicht.
Schade finde ich nur, dass es dir nicht gelingt, einmal die Perspektive zu wechseln. Deine ansatzweisen Reflexionen bleiben sehr oberflächlich und haben eher den Charakter von Rechtfertigungen.
Seltsam, dass du nicht einmal die Überlegung anstellst, warum ein Kind, Interesse haben sollte, spitze Schreie auszustoßen. Hatte es die Absicht, den Vater zur Weißglut zu bringen. Und wenn ja, warum?
Hattest du deinen Vater absichtlich zur Weißglut bringen wollen, bevor er sich nicht anders zu helfen wusste, als dich in die Badewanne zu stecken und dich eiskalt abzuduschen, um dich (oder sich) zu beruhigen?
Hattest du nicht selbst über hunderte von Seiten beschrieben, wie du als Kind, genau das auf jeden Fall vermeiden wolltest: den Vater wütend zu machen. Wie kannst du, nachdem du Zeit hattest, nach Jahren diese Situationen noch einmal Revue passieren zu lassen, um sie in dein Buch aufzunehmen, einen so, entschuldige den Ausdruck, dummen Satz schreiben: »Wenn ich zurückblicke, fällt mir auf, dass sie als knapp Zweijährige so unser ganzes Leben zu prägen vermochte. Denn so war es, eine zeitlang drehte sich alles nur noch darum.«
Ist dir nie in den Sinn gekommen, dass das Gegenteil der Fall sein könnte, dass du, dass ihr das komplette Leben eurer Tochter bestimmt habt. Dass sie so gut wie keine einzige Entscheidung treffen konnte. Dass sie vermutlich nie gehört wurde, bevor sie ihre Schreie losließ? Ist dir das wirklich nie in den Sinn gekommen? Du müsstest doch wissen, wie schwer es ist, sich als Kind bei einem unzugänglichen Vater Gehör zu schaffen.
Zu allem, was das Leben mit Kindern angeht, schreibst du, musstest du, musstet ihr euch zwingen. Das ist gut beobachtet. Aber du schreibst leider nichts darüber, wie denn die Kinder, es waren ja wohl drei, so unerwartet in euer Leben getreten sind?
Eigentlich eine Zumutung, einfach so ungefragt aufzutauchen und euer Leben bestimmen zu wollen. Was haben eure Kinder sich dabei gedacht?
»Und stecke ich erst einmal in diesem Sumpf, führt jede neue Handlung nur dazu, dass ich noch eine Drehung tiefer hineingebohrt werde. Und mindestens genauso schlimm ist es, zu wissen, dass ich es mit Kindern zu tun habe.« Okay jetzt kommt eine überraschende Wendung. Denn ich erwarte, die Erkenntnis, dass die Kinder natürlich alle Aufmerksamkeit verdient haben. Aber es kommt anders: »Dass es Kinder sind, die mich hinunterziehen. Das hat etwas zutiefst Entwürdigendes. In Situationen wie diesen bin ich soweit von dem Menschen entfernt, der ich sein möchte, wie es nur geht. Nichts von alldem ahnte ich, bevor ich Kinder bekam.«
Nach deinem weinerlichen Lamento über die nervigen Kinder, kommt dann auch, die übliche männlich machohafte, genauso unreflektierte wie reflexartige Erwähnung der Honorarzahlungen, die das ganze wenigstens einigermaßen am Laufen halten.
Damit reihst du dich, jetzt nicht mehr so überraschend unreflektiert, ein in das verbreitete patriachiale und über Generationen hinweg millionenfach repetierte, Kinder seid still, Papa muss arbeiten, Papa muss sich von der Arbeit ausruhen, Papa muss sich auf die Arbeit vorbereiten und leistest dieser antiquierten Haltung weiteren Vorschub.
Du schreibst, Glück war nie dein Ziel. Das ist großartig, vielleicht schon einfach deshalb, weil es selten ist. Du weißt auch genau, dass nicht die Familie dein Ziel ist. Warum setzt du dann ein Kind nach dem anderen in die Welt? Würdest du ein Buch nach dem anderen schreiben, wenn es nicht dein Ziel wäre, Schriftsteller zu sein? Du rufst, wie du selbst sagst, das etwas satirische Bild einer durchschnittlich zufriedenen, etwas spießigen, kleinbürgerlichen Otto-Normal-Familie auf. Du fragst:»Warum soll die Tatsache, dass ich Schriftsteller bin, mich von dieser Welt ausschließen?«
Es ist in meinen Augen nicht die Tatsache, dass du Schriftsteller bist, die dich aus dieser Welt ausschließt. Es ist die Tatsache, dass du keine kreative Energie in das Projekt Familie steckst. Du seilst dich altmodisch in die »Arbeit« ab, wo es nur geht. Nicht anders als es so viele Väter in genau den spießigen Familien tun, die du einerseits anprangerst und anderseits beneidest.
Als Jugendlicher hast du miterlebt, miterleben müssen, wie deine eigene kleinbürgerliche Familie scheitert. Dass du nicht das kleinbürgerliche Leben der Büroangestellten, der Lehrer mit scheinbar heilen Familien führen willst, ist geschenkt. Du willst es nicht nur nicht, du kannst es ja auch einfach nicht. Du bist Künstler. Durch und durch. Freiheitsliebend, sensibel, besessen vom Schaffensdrang. Und du kannst und musst schreiben, was und wie du willst.
Aber du kannst nicht erwarten, dass die Leser*innen ihr Gehirn ausschalten und sich ganz von deinem Text wegspülen lassen, auch wenn du ihnen bullshit unterjubelst.
An einer Stelle schreibst du, und da klingt in meinen Ohren etwas Stolz mit, dass du gelernt hättest, das Leben und seine Anforderungen einfach zu ertragen. Nun, auszurasten und seine Kinder vor Wut aufs Bett zu werfen ist alles andere als gleichmütiges Ertragen, das ist in meinen Augen volle resistance gegenüber den Anforderungen, die »das Leben« stellt.
Außerdem ist es alles ander als kreativ, das Leben als ganzes und die Familie im Besonderen einfach nur zu ertragen, wie du glaubst, es tun zu müssen. Das ist alles andere als künstlerisch, alles andere als schaffenskräftig. Kein Funken Gestaltungskraft ist da zu spüren. Und das ist schade.
Was wäre möglich gewesen, wenn du dich auf die Familie, die Kinder eingelassen hättest, was hättest du nicht alles schreiben können. An neuen Erkenntnissen. An neuem Umgang mit Kindern. Anders als in den spießigen Familien, die sie nur durch die Schule in den nächsten sicheren Job und das Eigenheim mit Vorgarten bringen wollen, um dann selbst als Großeltern in diesen Gärten auf die Enkel aufzupassen, bis die in die Schule gehen …
Ja, die kleinbürgerliche Familie scheitert immer öfter. Weil sie an ihre Grenzen stößt. Frauen bleiben nicht in der Küche, Männer sind nicht die Alleinverdiener, Kinder dürfen nicht mehr geschlagen werden.
Da hätte ein künstlerischer, kreativer Ansatz, der neue gangbare Wege sucht, eine viel größere Chance auf »Einzigartigkeit« Stattdessen sehe ich einen Rückzug aus der Welt in die Komfortzone des Schreibens, wie es so auch viele deiner Kollegen machen. Und bei dir obendrein in die scheinbar endlose Gleichförmigkeit des Vor-sich-hin-Schreibens, des Lamentierens über den Vater auf der einen Seite, des Lamentierens über die Kinder auf der anderen Seite. Aus der ganzen Schreiberei keine Erkenntnis. Keinen Schritt weiter. Keine neue Sicht auf die Welt. Da ist nichts Einzigartiges, auch wenn es dir die ganze Welt bescheinigt. Sie dich mit Preisen, Anerkennung und Ehren überhäuft und im Gegenzug von dir ihre alten liebgewonnenen Vorurteile bestätigt bekommt.
Ja, wir tabuisieren den Tod, ja in Krankenhäusern gibt es spezielle Fahrstühle für die Leichentransporte, ja das beschreibst du schön, aber da findet sich kein neuer Gedanke, geschweige denn ein einzigartiger. Und ja, Männer, und nicht nur Schriftsteller, setzen immer wieder Kinder in die Welt, obwohl sie glauben, dass sie für etwas Wichtigeres auf der Welt sind, als sich um ihre Kinder zu kümmern. Auch dazu findet sich kein neuer Gedanke in deinem Buch und schon gar kein einzigartiger. Im Gegenteil.
Leider eher einer, der dieser seltsamen längst überholten Vorstellung weiter Auftrieb gibt und sie zementiert. Die Papas nicken dir aus ihren Autos zu auf dem Weg in die Bank. Den Knausgård haben sie ja gelesen, oder wenigstens mal reingehört. Der sagt auch, dass Kinder nerven und einen von der Arbeit abhalten. Der überflüssigen.
Liebe Grüße
Uwe




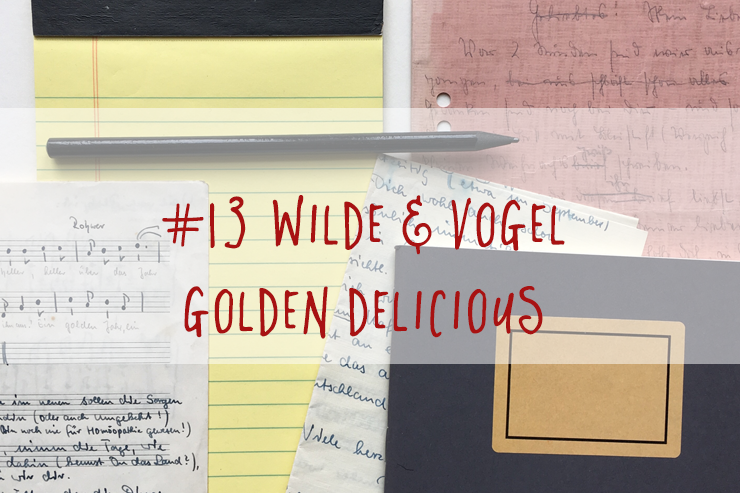
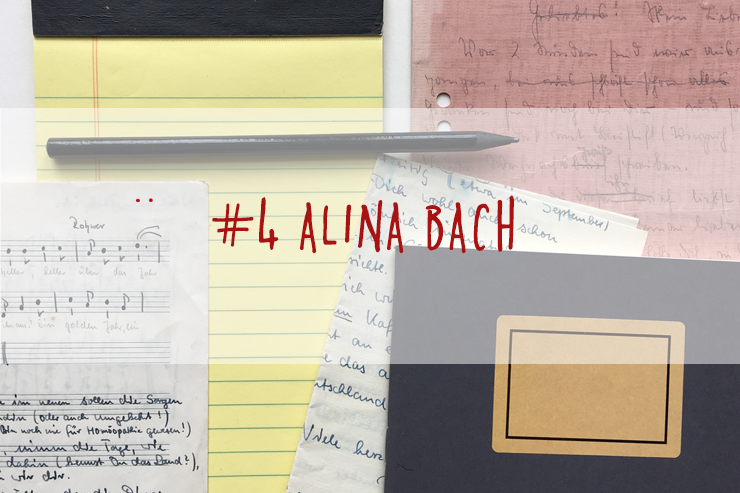
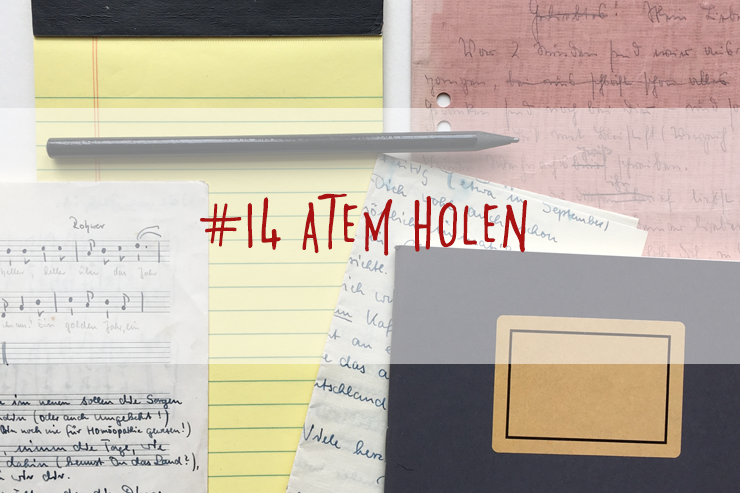
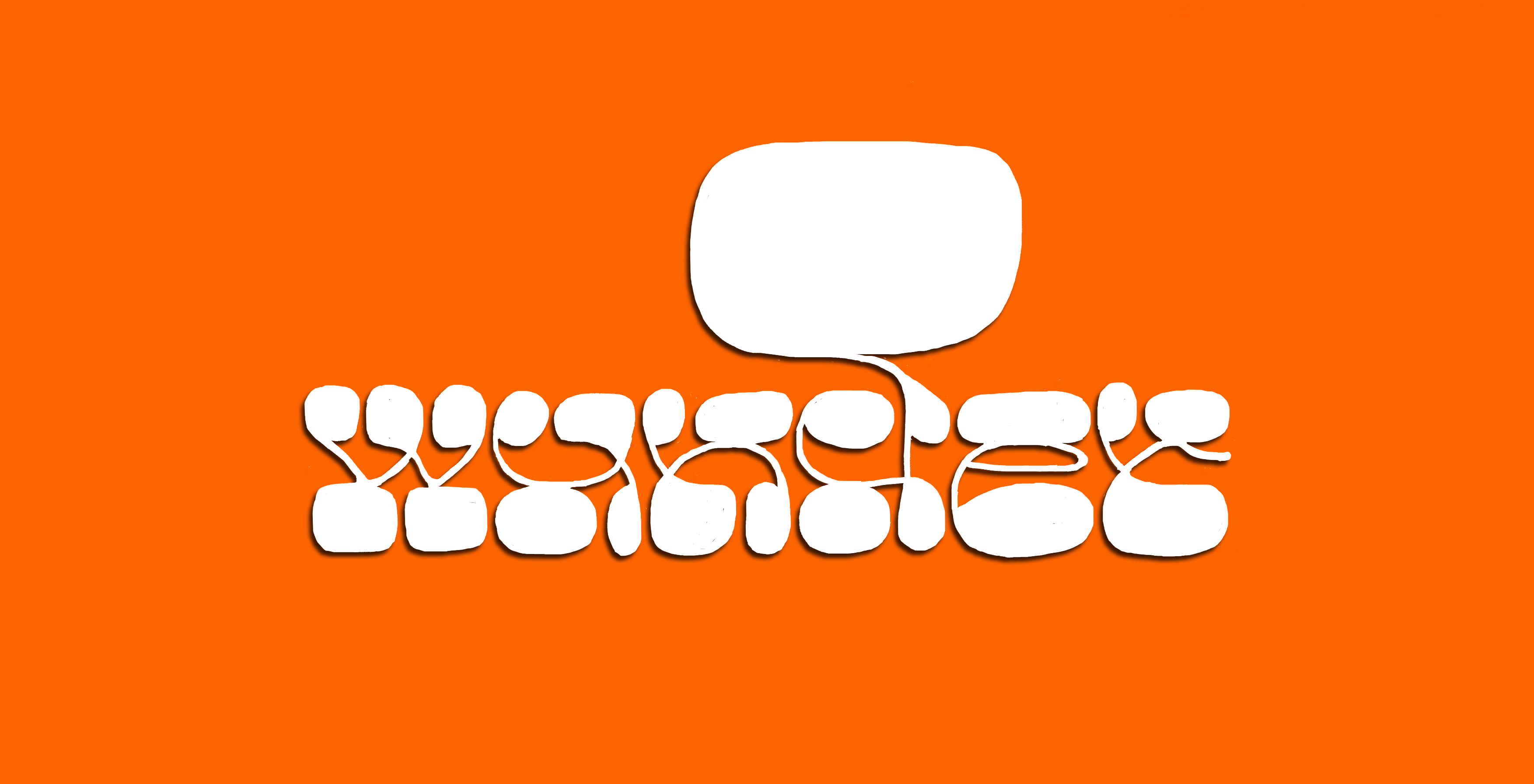
12 Comments