Liebe Leser*innen, liebe Autor*innen, heute geht es in der Reihe über autobiographisches Schreiben um ein Buch von Merethe Lindstrøm. Aus den Winterarchiven, 2018 erschienen bei Matthes und Seitz, Berlin. Übersetzt aus dem Norwegischen von Elke Ratzinger.
Wie in dem Buch von Alina Bach, das ich in der letzten Woche vergestellt habe, geht es auch in diesem um eine Beziehung, in der der Partner der Autorin depressive Phasen durchleidet. Im Laufe des Buches erfährt man, dass bei ihm Bipolarität diagnostiziert wurde. Und natürlich leidet nicht nur er unter der Krankheit, sondern mit ihm seine ganze Familie.
Ich möchte in diesem Beitrag allerdings nicht so sehr auf den Inhalt eingehen. Nur so viel: Die Autorin Merethe ist mit ihrer Familie auch aus finanzieller Not in die Einöde gezogen. In diesem kleinen Haus am Waldrand möchte sie mit ihrem depressiven Freund Mats zur Ruhe kommen, indem sie schreibt. Über sich, über ihn, ihre Angst um ihn und ihre Angst um sich. Und sie schreibt über das Schreiben. Das ist für mich der interessanteste Aspekt des Buches.
Ein düsteres Buch.
Lindstrøm nennt es einen Roman.
Die Autorin ist die Hauptfigur. Sie schreibt. Und sie schreibt zum Großteil – aber nicht nur – in der ersten Person Singular. Im Präsenz.
Ihr Partner ist ständig da, wird aber nicht wirklich sichtbar.
Du hast die riesige Kapuze auf, versteckst dich darunter, dein Gesicht ist für mich nicht zu sehen.
Er ist das Gegenüber, er ist das DU. Aber er ist nicht wirklich der Adressat, an den sich der Text richtet. Sie erwartet nicht, dass er den Text, dass er sie wahrnimmt.
Die Beziehung ist sprachlos. Auf der Suche nach Ursachen begibt sie sich immer wieder in die Vergangenheit. Dabei wechselt sie immer wieder die Perspektive. Oft weiß der Leser, so ist es jedenfalls mir gegangen, nicht von welcher Zeit, von wessen Kindheit gerade die Rede ist.
Sie findet sehr viele mögliche Ursachen für ihre Situation, für die Krankheit, die Depression und die Sucht. Kann daraus aber keine Handlungsanleitungen, keine potentiellen Lösungen ableiten. Die existenzielle Hilflosigkeit der beiden, spiegelt sich und der Hilflosigkeit im Schreiben.
Ich kann anscheinend oft nur wiedergeben, was ich sehe, Schlussfolgerungen sind unmöglich, flüchtig.
Schreiben als Thema
So wie auch Isabelle Lehn macht Merethe Lindstrøm ihr Schreiben zum Thema.
Sie stellt dem Buch ein Motto von CLARICE LISPECTOR voran:
Ich schreibe als gälte es, jemandem das Leben zu retten. Wahrscheinlich mir selbst. Leben ist eine Art Wahnsinn, den der Tod unternimmt.
Bei Isabelle Lehns Protagonistin ist das Schreiben eine Form der Kommunikation. Sie hat ein Gegenüber im Blick. Einen Leser oder eine Leserin. Sie stellt Überlegungen zum Erscheinen des Buches an, zu Gesprächen mit der Lektorin, zum Marketing, und zu den Reaktionen von Leser*innen an.
Für Merethe Lindstrøm ist Schreiben der Rettungsanker. Der Erste Hilfe Koffer. Sie scheint für sich selbst zu schreiben. Es ist ein Dialog mit sich selbst. Nein, ein aus ihr herausfließender Monolog. Eher wie in einem Tagebuch. Eine Form sich seiner selbst zu vergewissern. Und eine Form sich abzulenken, von sich, von seiner Situation, von den Menschen um sich herum.
Sie läßt sich in das Schreiben fallen. Schreibt gewissermaßen automatisch. Einmal heißt es:
Ich schreibe den ganzen Morgen, schreibe die meiste Zeit des Tages, ich schreibe über unsere Kinder, über die Kindheit. Ich weiß nicht, was ich schreibe.
Die Notwendigkeit des Schreibens
Es ist wie eine Art Zwang, den sie nicht einmal für ein Gespräch mit einer ihrer Töchter unterbrechen kann.
In einer sehr offenen, bewegenden Passage kommt die kleine Tochter Dagne zu ihr:
Was schreibst du, fragte sie, damals war sie fünf oder sechs. Sie stand in der Tür zum Schlafzimmer, wo ich in unserem früheren Haus schrieb. Kann ich gerade nicht erzählen, sagte ich. Ich muss mich konzentrieren, Dagne, ich muss schreiben.
Die Tochter braucht vielleicht die anwesende Mutter. Die, die mit ihr redet, statt zu schreiben.
Ich will nicht, dass du schreibst, sagte sie. Ich kann nicht aufhören, sagte ich. Wie die Prinzessin, die nicht mit dem Tanzen aufhören kann?, fragte sie. Sie war nähergekommen. Vielleicht, sagte ich. Sie stand neben mir, neben dem Schreibtisch. Tut es weh? Manchmal, sagte ich.
Die Tochter will ihr aus dem Schreiben helfen.
Meine Finger lagen auf der Tastatur, sie hatte ihre Hand auf meine gelegt, auf meine rechte Hand. Sie ließ sie dort, ihr molliges Patschehändchen, an den Fingerkuppen tintenverschmiert, lange Finger, wie meine, ein verletzter Nagel, den sie sich eingeklemmt hatte, war an der Wurzel rot. Jetzt kannst du nicht mehr, sagte sie. Ich helfe dir. Ich lasse meine Hand hier.
Die Mutter, die Autorin, Merethe Lindstrøm, die Schreibbesessene wird wütend:
Ich sagte: Nimm deine Hand von der Tastatur, Dagne. Lass meine Hand los. Härter, wütend. Sie zog sie zurück. Schnell, als hätte jemand sie gestochen, ihr die Haut verbrannt.
Obwohl Antworten vielleicht so nah liegen – das ist von mir unterstellt – in der Hinwendung zu der Tochter, sucht sie weiter Antworten im Schreiben.
Aber das Schreiben bringt keine Antworten.
Ich sollte schreiben, die Hunde schreiben, die Landschaft und das, was ich sehe, mich aus der Schwere schreiben, aber ich gerate ständig ins Stocken, ich spüre, es stimmt so nicht, selbst wenn das, was ich schreibe, wahr ist, kriege ich nicht hin, dass es stimmt.
In Ermangelung stimmiger Wahrheiten läßt sie sich immer wieder auf Beobachtungen ein. Nicht auf Überlegungen. Sie schreibt wie im Rausch. Sie schreibt im Rausch.
Ich bin besoffen, ich trinke seit Stunden, ich wollte das hier besoffen schreiben, nein, ich wollte nachts schreiben, und zufälligerweise bin ich besoffen. Allein, im Dunkeln, fürs Betrunkensein die beste Zeit, der Rausch, wie auch die Nacht, wird sich in die Seiten des Notizbuchs mengen und sie aufrichtiger machen.
Ist es so, dass Betrunkene aufrichtiger sind, die Wahrheit sagen?
Mit Rausch oder ohne, in der Nacht geschriebene Notizen sind am Morgen immer fremd. Die Nacht befördert etwas hoch, zeigt es, wie es ist, das Vergessene, ist denn die Sprache nachts nicht eine andere, die Nachtsprache, ist sie nicht wahrer, ich glaube schon.
Der Text übernimmt
Ich brauche Chaos, beim Schreiben muss ich den Text, die Sätze überlisten. Den Text zieht es in eine Richtung, die Sätze, diese angeleinten Hunde ziehen dorthin, wohin sie wollen, ziehen uns auf dem gewohnten Weg nach Hause, das ist am einfachsten, macht sich von selbst, was ich aber brauche, ist versteckt, das Beste ist schwierig, es liegt im Chaos. Immer zufällig, kurz, im Aufblitzen.
Der Text wird ihr fremd, der Text gewinnt die Oberhand. Das Schreiben selbst, der Text soll etwas Wahrhaftiges hervorbringen. Dabei ist ihr klar dass der Text ein Eigenleben hat, einer eigenen Logik folgt. Und der Text zieht, wie sie an einer Stelle schreibt, immer wieder in die gleiche Richtung. Trifft nur zufällig »das Beste«. Sie vergleicht die Sätze mit Hunden, die an der Leine ziehen. Sie bestimmen wo’s langgeht. Die Hundeführein stolpert nur noch hinterher.
Dabei möchte sie die Kontrolle behalten,
möchte etwas schreiben, dem entgegenarbeiten, was vorbestimmt scheint, diese unbeugsame Richtung des Verkehrs, aber im gleichen Satz verliert sie sich schon wieder in Beobachtungen und ihr Blick fällt (wieder) auf einen Hund, der die Straße entlangläuft, er bellt, hat jemanden getroffen oder auf der anderen Seite etwas entdeckt, verschwindet in seinem eigenen Geräusch …
Obwohl sie dagegenhalten möchte, driftet der Text wieder ab in Beobachtungen. Folgt dem Hund die Straße entlang in immer selbstzerstörerischere Bilder.
Und sie weiß:
dass man sich (so) ununterbrochen zu größer werdendem Zweifel schreibt.
Der Schreiben muss versagen, wenn es Sicherheit geben soll. Merethe Lindstrøm läßt sich durch den Text treiben und der ständige Strom von Beobachtungen, Gedanken, Überlegungen und Empfindungen fließt immer wieder in gleiche Richtung. In die Beobachtung der Hilflosigkeit.
Und genau dadurch gelingt ihr, das zermürbende Zusammenleben mit der Krankheit in Sprache zu fassen, ohne dass sie durch diese Ästhetisierung den Schrecken verliert. Ein Abbild der Hilflosigkeit.
Merethe Lindstrøm hat in großartigen, poetischen Bildern ein bedrückendes Buch über Hilflosigkeit, Depression und das Schreiben selbst geschrieben.
Bis nächste Woche, frohes Schreiben ;)
Uwe

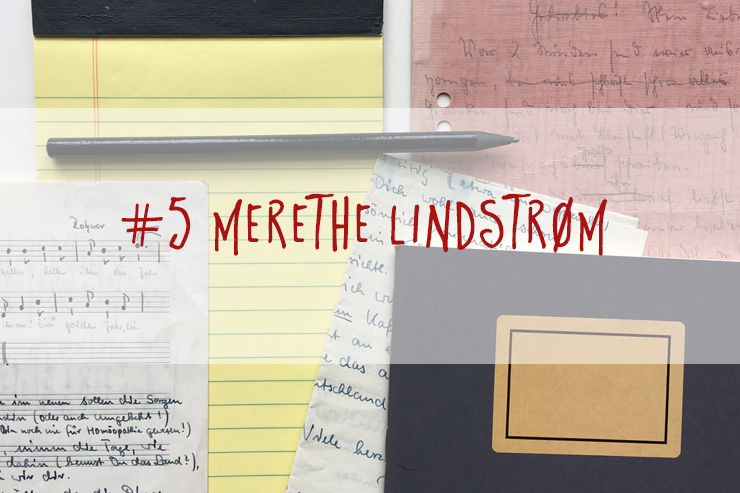

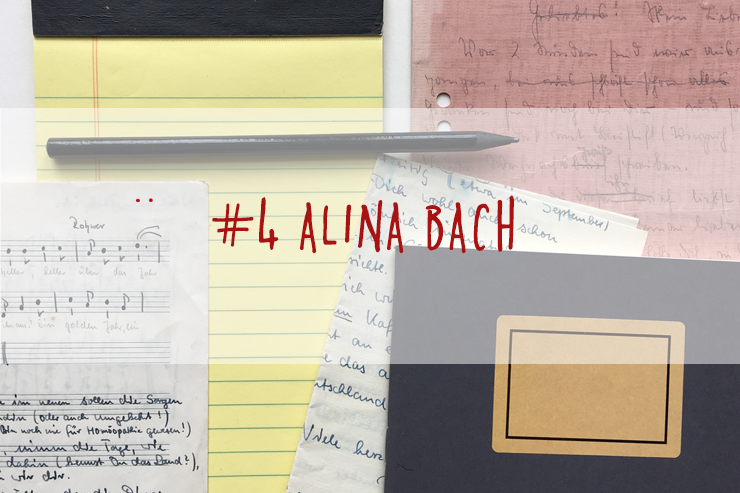



5 Comments